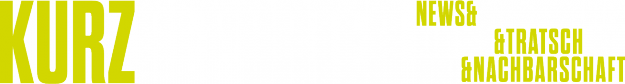Was bringt die neue Elfer-Nummer für Kassenpatienten?
Berlin – Wenn sie einen Termin beim Arzt brauchen, melden sich die meisten einfach direkt in der Praxis. Doch manchmal ist das nicht so leicht: Weil ein Spezialist erst Wochen später Zeit für sie hat.
Oder wenn einem abends unwohl wird, und man nicht weiß, wo es eine offene Praxis gibt. Manche gehen dann lieber gleich ins Krankenhaus – stundenlanges Warten in der Notaufnahme oft inklusive. Für all solche Fälle sollen sich Kassenpatienten bald nur noch eine Telefonnummer merken müssen: 116 117. Die Koalition verordnete der bisher eher in der Nische steckenden Hotline einen Neustart zum 1. Januar 2020.
Die «Elf-sechs-elf-sieben» sei die Nummer, die eigentlich jeder kennen müsste, sagt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. Denn sie soll künftig eine rundum zuständige Nummer für alle Patienten sein, die nicht schon direkt einen Termin haben. Momentan ist sie vielen Bundesbürgern allerdings noch gar kein Begriff – um das zu ändern, ist ab Ende August eine Werbekampagne geplant. Zum Start des erweiterten Angebots ist nicht mehr viel Zeit.
Was ändert sich bei der 116 117?
Schon seit 2012 gibt es die Nummer für den Bereitschaftsdienst der Ärzte außerhalb der Praxiszeiten, also nachts und je nach Bundesland an manchen Nachmittagen. Künftig soll sie jeden Tag und rund um die Uhr erreichbar sein. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in den Ländern stocken ihre Call Center dafür derzeit massiv auf, wie es bei der KBV heißt. Zum Start des neuen Angebots sollen es bundesweit 1200 Mitarbeiter sein. Damit verzahnt werden sollen auch schon bestehende Servicestellen, die telefonisch Termine bei Fachärzten vermitteln. Auch sie sind bisher aber je nach Land zu diversen Zeiten erreichbar.
Was passiert künftig bei Anrufern mit akuten Anliegen?
Hat ein Kleinkind hohes Fieber oder ein älterer Mann nach einem Wespenstich plötzlich rote Flecken, soll die 116 117 künftig ein «Wegweiser» für sie sein. Patienten sollen am Telefon eine erste Einschätzung bekommen, wie dringlich sie behandelt werden müssen, sofern es kein Notfall ist: schnellstmöglich, binnen 24 Stunden oder später. Medizinisch geschulte Mitarbeiter im Call Center sollen dafür mit Hilfe einer neuen Software Symptome, Vorerkrankungen und Risikofaktoren abfragen – und Patienten, je nachdem, in eine Praxis oder eine Klinik weiterlotsen. Um eine Diagnose geht es noch nicht.
Was passiert bei Anrufern auf Terminsuche?
Als Alternative zum direkten Nachfragen in der Praxis vermitteln «Terminservicestellen» schon jetzt freie Sprechzeiten bei Fachärzten binnen vier Wochen, aber nicht unbedingt beim Wunscharzt. Künftig sollen über die 116 117 auch Termine bei Haus- und Kinderärzten zu bekommen sein, auch zur dauerhaften Betreuung. Praxen sollen freie Zeiten dafür in ein System einstellen. Als Anreiz winkt auch extra Geld für Patienten, die so vermittelt wurden. Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) begrüßen das einheitliche Angebot. 17 unterschiedliche Nummern und Erreichbarkeitszeiten in den KV-Bezirken seien «alles andere als patientenfreundlich», sagt Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand des GKV-Spitzenverbands. Künftig könne auch besser koordiniert werden, welche Fälle wirklich eilig seien.
Wie geht es weiter?
Wie die Hotline angenommen wird und wie reibungslos dann alles funktioniert, muss sich im neuen Jahr zeigen. Die KBV-Experten rechnen für 2020 mit rund zehn Millionen Anrufern nach gut sieben Millionen beim kleineren «alten» Angebot im vergangenen Jahr – bei übrigens insgesamt mehr als 500 Millionen Behandlungsfällen in den Praxen pro Jahr. Die Zukunft der 116 117 hängt auch noch von einer Reform der Notfallversorgung ab, die Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) parallel angeschoben hat. Vorgesehen sind darin unter anderem gemeinsame Leitstellen mit dem bekannten Notruf 112. Und ungewiss ist auch noch, ob an Stelle der Kassenärztlichen Vereinigungen künftig womöglich die Länder für die Sicherstellung der Patientenversorgung außerhalb der Sprechstundenzeiten zuständig sein sollen.
Fotocredits: Patrick Pleul
(dpa)