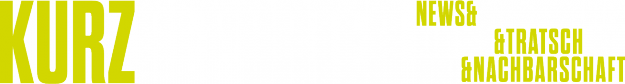Überwachungskamera-Video kann Jobverlust rechtfertigen
Erfurt – Kaum ein Handgriff blieb unbeobachtet: In einem Zigaretten- und Zeitschriftengeschäft in Nordrhein-Westfalen sollte eine offen aufgehängte Überwachungskamera Waren und Mitarbeiter vor Dieben schützen. Letztlich dienten die Kamerabilder dem Arbeitgeber für eine fristlose Kündigung der Verkäuferin.
Die gespeicherten Videoaufzeichnungen, die erst nach Monaten ausgewertet wurden, belegen seiner Meinung nach, dass die Frau in die Kasse griff. Doch können die alten Bilder der Überwachungskamera überhaupt als Beweis dienen? Ja, sagten die höchsten deutschen
Arbeitsrichter in Erfurt in einem Grundsatzurteil.
Was für ein Fall wurde verhandelt?
Am 13. August 2016 erhielt die Verkäuferin eine fristlose Kündigung – «wegen der begangenen Straftaten», ließ sie ihr Arbeitgeber wissen. Damit war für die Mittvierzigerin aus Nordrhein-Westfalen ihr Minijob für monatlich 450 Euro brutto in einem Tabak- und Zigarettenladen mit angeschlossener Lottoannahme beendet. Ihr Arbeitgeber hatte bei einer Stichprobenkontrolle einen «Warenschwund» festgestellt. Er ließ von einer seiner Angestellten über sechs Monate gespeicherte Aufzeichnungen der Überwachungskamera analysieren. Mindestens an einem Tag soll die Frau in drei Fällen Tabakwaren verkauft und das Geld – 35 Euro – nicht in die Registrierkasse gelegt haben.
Wie reagierte die Verkäuferin?
Sie bestreitet, Geld unterschlagen zu haben und klagte gegen die fristlose Kündigung. Mit Erfolg: Das Arbeitsgericht Iserlohn erklärte die Kündigung für unwirksam, später auch das Landesarbeitsgericht Hamm. Die zweite Instanz bescheinigte dem Arbeitgeber die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Der Arbeitgeber hätte die Kamerabilder regelmäßig überprüfen und dann unverzüglich löschen müssen. Durch den Verstoß gegen den Datenschutz bestehe ein «Beweisverwertungsverbot» für die Videoaufzeichnungen, heißt es in dem Urteil aus Hamm.
Was entschied das Bundesarbeitsgericht?
Nach Ansicht der Bundesrichter gibt es kein Verwertungsverbot für legale Videoaufzeichnungen von einer offen installierten Kamera – nur weil sie länger gespeichert sind. Im Gegenteil: Der Arbeitgeber «musste das Bildmaterial nicht sofort auswerten. Er durfte hiermit so lange warten, bis er dafür einen berechtigten Anlass sah», urteilten sie und verwiesen den Fall zurück an das Landesarbeitsgericht Hamm. Der Nutzung von Bildern einer rechtmäßig offenen Videoüberwachung als Beweis vor den Arbeitsgerichten ständen auch die Vorschriften der neuen
Datenschutz-Grundverordnung von Ende Mai nicht entgegen.
Worin liegt die grundsätzliche Bedeutung des Falls?
Die Digitalisierung mit neuen Überwachungsmöglichkeiten wie Keyloggern, die jeden Tastenanschlag auf Dienst-PCs protokollieren, sorgen für eine Datenflut. In der Frage, welche Anforderungen an Datenbeweise vor Gericht gestellt werden müssen, sorgt das Urteil der Bundesarbeitsrichter für mehr Klarheit. Bilder, die Verfehlungen von Arbeitnehmer dokumentierten, würden «nicht durch bloßen Zeitablauf unverhältnismäßig».
Wie ist die bisherige Rechtsprechung zur Videoüberwachung?
Seit dem sogenannten Bespitzelungsskandal mit versteckten Kameras beim Discounter Lidl, der 2008 publik wurde, gab es immer wieder Arbeitsgerichtsurteile zur digitalen Überwachung. Grundsätzlich dürfen keine Daten genutzt werden, bei deren Beschaffung das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gebrochen wird, sagen Arbeitsrechtler.
Gibt es Voraussetzungen, um versteckte Kameraaugen oder Spähsoftware auf Arbeitsplätze zu richten?
Ja. Videoüberwachung sei nur dann möglich, «wenn sie streng verdachtsbezogen erfolgt und dann nur in einer begrenzten Zeit», sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsgerichts. «Sie muss die absolute Ausnahme sein.» Vor einem Jahr hatte das BAG in einem Keylogger-Fall entschieden: Die Spähsoftware auf Firmenrechnern sei zur Überwachung von Arbeitnehmern «ins Blaue hinein» rechtswidrig. Einzige Ausnahme: Es liegt ein durch Tatsachen begründeter Verdacht auf eine Straftat oder eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Arbeitnehmers vor.
Fotocredits: Martin Schutt
(dpa)