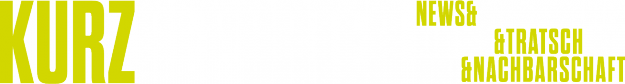Sicherheitslücke bei Computerchips trifft Milliarden Geräte
Santa Clara – Durch eine neu entdeckte Sicherheitslücke in Computerchips von Milliarden Geräten können auf breiter Front vertrauliche Daten abgeschöpft werden. Forscher demonstrierten, dass es möglich ist, sich Zugang zu Passwörtern, Krypto-Schlüsseln oder Informationen aus Programmen zu verschaffen.
Die Tech-Firmen sind dabei, die seit zwei Jahrzehnten bestehende Lücke mit Software-Aktualisierungen zu stopfen. Komplett kann das Problem aber nur durch einen Austausch der Prozessoren beheben.
Die Schwachstelle liegt in einem Verfahren, bei dem Chips möglicherweise später benötigte Informationen schon im voraus abrufen, um Verzögerungen zu vermeiden. Diese als «speculative execution» bekannte Technik wird seit Jahren branchenweit eingesetzt. Damit dürfte eine Masse von Computer-Geräten mit Chips verschiedenster Anbieter zumindest theoretisch bedroht sein. Das Schlimme an der Schwachstelle ist, dass alle auswendigen Sicherheitsvorkehrungen um den Prozessor herum durch den Design des Chips selbst durchkreuzt werden könnten.
Sie wüssten nicht, ob die Sicherheitslücke bereits ausgenutzt worden sei, erklärten die Forscher. Man würde es wahrscheinlich auch nicht feststellen können, denn die Attacken hinterließen keine Spuren in traditionellen Log-Dateien.
Der Branchenriese Intel erklärte, es werde gemeinsam mit anderen Firmen an Lösungen gearbeitet, bezweifelte aber zugleich, dass die Schwachstelle bereits für Attacken benutzt wurde. Der kleinere Intel-Konkurrent AMD, der von den Entdeckern der Sicherheitslücke ebenfalls genannt wurde, bestritt, dass seine Prozessoren betroffen seien. Der Chipdesigner Arm, dessen Prozessor-Architektur in Smartphones dominiert, bestätigte, dass einige Produkte anfällig dafür seien.
Die IT-Sicherheitsstelle der US-Regierung, CERT, zeigte sich kategorisch, was eine Lösung des Problems angeht: «Die Prozessor-Hardware ersetzen.» Die Sicherheitslücke gehe auf Design-Entscheidungen bei der Chip-Architektur zurück. «Um die Schwachstelle komplett zu entfernen, muss die anfällige Prozessor-Hardware ausgetauscht werden.»
Die komplexe Sicherheitslücke war von den Forschern bereits vor rund einem halben Jahr entdeckt worden. Die Tech-Industrie arbeitete seitdem im Geheimen daran, die Schwachstelle mit Software-Updates soweit möglich zu schließen, bevor sie publik wurde. Die Veröffentlichung war für den 9. Januar geplant. Die Unternehmen zogen sie auf Mittwoch vor, nachdem Berichte über eine Sicherheitslücke in Intel-Chips die Runde machten. Der Aktienkurs von Intel sackte ab, der Konzern sah sich gezwungen, «irreführenden Berichten» zu widersprechen und betonte, es handele sich um ein allgemeines Problem.
Die Forscher, die unter anderem bei
Google arbeiten, beschrieben zwei Attacken auf Basis der Schwachstelle. Bei der einen, der sie den Namen «Meltdown» gaben, werden die grundlegenden Trennmechanismen zwischen Programmen und dem Betriebssystem ausgehebelt. Dadurch könnte böswillige Software auf den Speicher und damit auch auf Daten anderer Programme und des Betriebssystems zugreifen. Für diese Attacke ist den Entdeckern der Schwachstelle zufolge nahezu jeder Intel-Chip seit 1995 anfällig – sie kann aber mit Software-Updates gestopft werden.
Die zweite Attacke, «Spectre», lässt zu, dass Programme einander ausspionieren können. «Spectre» sei schwerer umzusetzen als «Meltdown» – aber es sei auch schwieriger, sich davor zu schützen. Man könne lediglich bekannte Schadsoftware durch Updates stoppen. Ganz sei die Lücke aber nicht zu stopfen. Von «Spectre» seien «fast alle Systeme betroffen: Desktops, Laptops, Cloud-Server sowie Smartphones», erklärten die Forscher. Man habe die Attacke auf Chips von
Intel und AMD sowie
Arm-Designs nachgewiesen.
Die Software-Maßnahmen gegen die Sicherheitslücken dürften zwar die Leistung der Prozessoren beeinträchtigen, räumte Intel ein. In den meisten Fällen werde der Leistungsabfall aber bei maximal zwei Prozent liegen. In ersten Berichten war noch von bis zu 30 Prozent die Rede.
Besonders brenzlig werden könnte das Problem zumindest theoretisch in Server-Chips, auf denen sich die Wege vieler Daten kreuzen. Die Cloud-Schwergewichte Google, Microsoft und Amazon erklärten, dass ihre Dienste mit Software-Updates abgesichert worden seien.
In den vergangenen Jahren hatten die Tech-Unternehmen ihre Geräte und Dienste unter anderem mit Verschlüsselung geschützt – gingen dabei jedoch davon aus, dass von den Prozessoren selbst keine Gefahr droht.
Fotocredits: Monika Skolimowska
(dpa)